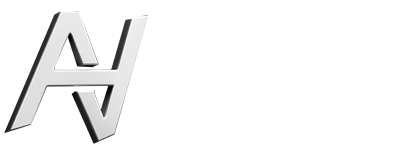Kapitel 1 – Die erste Narbe
Teil 1 – Die erste Begegnung mit einer neuen Welt
Es war Weihnachten 1988 am Nachmittag, ich war zehn Jahre alt, als sich etwas veränderte. Unter dem Baum lag ein grauer Kasten. Auf der Front prangte ein Name: Commodore C=64. Für viele war es nur ein Computer. Für mich war es der Schlüssel in eine neue Welt.
Ein paar Wochen zuvor war ich bei Verwandten gewesen. Dort stand so ein „Brotkasten“. Man konnte darauf nicht nur Spiele spielen, sondern auch programmieren. Schon damals faszinierte mich das und ich wünschte mir sehnlichst, selbst so ein Gerät zu besitzen.
Ich erinnere mich genau an den Moment, als ich ihn einschaltete. Zum ersten Mal erschienen diese hellblauen Buchstaben auf dem Bildschirm. Dieses grelle Blau auf dem blauen Hintergrund wirkte auf mich wie eine Botschaft aus einer anderen Dimension. Es klickte sofort in meinem Kopf. Doch ich wusste nicht, wie ich das Ding überhaupt starten sollte. Also half mir mein Verwandter am Telefon durch die ersten Schritte.
Von da an saß ich stundenlang davor, probierte Befehle aus, verstand nicht alles, aber spürte: Hier ist eine Welt, in der unendlich viel möglich ist.
Meine Eltern sahen nur einen Jungen, der „am Computer spielt“. Ich wusste, dass es mehr war. Für mich war es das Gefühl, etwas erschaffen zu können. Ich lernte, wie man Befehle schreibt, kleine Programme bastelt. Ich kaufte mir dicke Bücher und stapelweise Zeitschriften, sog alles auf, was ich finden konnte. Es war Magie: Ich konnte den Bildschirm verändern, Figuren bewegen, etwas Eigenes in die Welt setzen.
In diesen Momenten ahnte ich, dass die Zukunft digital sein würde – und dass ich irgendwann Teil davon sein wollte.
Doch das war Zukunftsmusik. In meiner Realität wartete ein ganz anderer Weg.
Teil 2 – Lehrjahre
Mit fünfzehn begann meine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker. Die Werkhalle lag nur 800 Meter von meinem Elternhaus entfernt ein kurzer Weg, aber er fühlte sich an wie ein Schritt in eine neue Welt. „Jetzt beginnt der Ernst des Lebens“, sagten meine Eltern immer. Und tatsächlich: Mit dem ersten Tag in der Halle war die Kindheit vorbei.
Schon der erste Atemzug dort war anders. Die Luft roch nach Öl und Eisenstaub. Metall auf Metall, das rhythmische Kreischen der Flex, der Funkenflug beim Schweißen ein Konzert aus Lärm und Arbeit. Hier war nichts weichgespült. Es war roh, hart und ehrlich. Hier ging es nicht um Fantasie, hier ging es um Realität. Um Dinge, die man anfassen, heben und am Ende stolz betrachten konnte.
Ich war Lehrling. Und wie jeder Lehrling musste ich mich beweisen. Doch ich lernte schnell vielleicht schneller als andere. Manche mochten mich deswegen nicht, vielleicht weil ich anders war, vielleicht weil ich Dinge hinterfragte. Aber unser Betriebsmeister setzte mich überall ein: Schweißen, Drehen, Bohren, Montieren. Ich war einer von nur zwei Lehrlingen, die das Privileg hatten, direkt mit dem erfahrensten Gesellen der Firma zu arbeiten.
Von ihm lernte ich nicht nur die Grundlagen, sondern auch die Geheimnisse, die in keinem Schulbuch standen. Schmieden zum Beispiel. Tricks, Kniffe, kleine Abkürzungen, wie man aus Erfahrung heraus effizienter arbeitet. „Eile mit Weile“, „Was du nicht im Kopf hast, musst du in den Händen und Füssen haben“. Diese Zeit war hart, aber auch lehrreich. Ich bekam Einblicke in fast jeden Bereich der Werkhalle und sog alles auf. Am Ende eines Arbeitstags durch die Halle zu gehen und die Teile, die ich mitgeschaffen hatte, zu sehen das erfüllte mich und war schön.
Doch während meine Hände schufteten, blieb mein Kopf oft woanders: bei den Computern. Ein halbes Jahr vor Beginn meiner Lehre hatte ich einen echten PC geschenkt bekommen. 2000 D-Mark kostete er. Es war ein 386er mit „wahnsinnig schnellen“ 40 Megahertz und einer Turbo-Taste, die mir damals wie ein Raketenantrieb vorkam.
Darauf programmierte ich grafische Anwendungen. Ich experimentierte, probierte aus, lernte. Schnell merkte ich: Ich wusste auf diesem Gebiet mehr als unser Informatiklehrer. Computer waren für mich keine Fremdsprache, sie waren mein zweites Zuhause.
Eines Tages sagte ein Lehrling zu mir, der kurz vor seinem Abschluss stand: „Andreas, du wirst in diesem Beruf nicht lange bleiben. Du kennst dich mit Computern aus das ist die Zukunft.“
1993 war das. Niemand von uns kannte damals das Wort „Internet“. Kaum jemand hatte eine Ahnung, wohin die Computerwelt führen würde. Für viele war es ein Spielzeug. Für mich war es schon damals mehr.
Ich war anders, ein „Nerd“. Aber ich wusste: Genau darin lag meine Stärke.
Teil 3 – Uniform, Drill und Kameradschaft
Nach der Lehre kam die Bundeswehr. Grundwehrdienst damals Pflicht. Für viele war es ein notwendiges Übel, für manche eine verlorene Zeit. Für mich wurde es eine Schule des Zusammenhalts.
Die ersten Wochen waren hart. Frühes Aufstehen, Marschieren, stundenlange Übungen, schweres Gepäck. Wir waren alle gleich: kahlgeschoren, müde, verschwitzt. Die Tage verschwammen in Drill, Befehlen und Wiederholungen. Doch zwischen all dem Druck entstand auch etwas anderes: ein Gefühl von Zugehörigkeit.
Ich war anfangs der Erste, der abends ins Bett wollte. Um 22 Uhr war offiziell Nachtruhe, Report & Licht aus. Doch meine Kameraden hatten andere Pläne. Sie tranken Bier, kippten Schnaps, rauchten bis tief in die Nacht. Manchmal bis ein Uhr. Wer nicht mitmachte, galt als Außenseiter. Ich wollte dazugehören, also setzte ich mich dazu, trank mit, hielt durch. Irgendwann war ich derjenige, der am längsten durchhielt. Zum Glück bin ich nie zum Alkoholiker geworden – es war eher ein Aufnahmeritual. Danach war der Zusammenhalt perfekt.
Später kam ein Neuer auf die Stube von den Feldjägern gebracht, weil er schon auffällig geworden war. Sofort wurde er unser „Opfer“. Er hielt nicht lange durch und schaffte es am Ende tatsächlich, den Grundwehrdienst vorzeitig zu verlassen. Für uns war das nur ein weiterer Beweis, dass nicht jeder dafür gemacht war.
Zwischen Drill und Alkoholritualen gab es auch ernste Momente. Ich erinnere mich an den Tag, als wir zum Truppenübungsplatz marschierten, um mit Gewehr, Maschinengewehr und Pistole zu schießen. Unser Offizier erzählte uns Geschichten von Unfällen – Soldaten, die durch Leichtsinn ums Leben kamen. Er sprach davon, wie einer einem anderen aus Versehen in den Kopf geschossen hatte, weil er die Waffe falsch hielt. „Die Schädeldecke war weg“, sagte er trocken. Ich wusste nicht, ob es eine typische Bundeswehr-Anekdote war oder die Wahrheit aber es brannte sich ein.
Dass diese Warnungen bitter ernst gemeint waren, erlebte ich selbst. Ein Rekrut nahm es nicht genau, hielt sein Gewehr falsch. Als der Offizier zu ihm ging, drehte er sich um und richtete die Mündung direkt auf ihn. In dem Moment krachte die Ohrfeige, und der Junge bekam richtig Ärger. Wir alle verstanden sofort: Mit diesen Waffen spielt man nicht.
Nach der Grundausbildung kam ich als Pionier ins Materiallager. Dort war es ruhiger. Ich musste für vier Wochen nach Hessen, um Lehrgänge zu absolvieren. Neue Kameraden, neues Umfeld, weniger Drill. Die Zeit war entspannter, fast schon angenehm. Es gab Lehrgänge, Aufgaben, aber auch viel „Zeit absitzen“. Und das Essen in der Kantine war oft das Highlight des Tages.
Wenn ich heute zurückblicke, war es keine Phase, in der ich über meine Zukunft nachdachte. Aber sie lehrte mich etwas, das mich bis heute begleitet: Einer alleine kann stark sein – aber im Team bist du unschlagbar.
Teil 4 – Geld, Gefahr und der Absturz
Nach der Bundeswehr kehrte ich zunächst in den Betrieb zurück, in dem ich gelernt hatte. Doch diesmal ging es nicht um die Halle, die Werkbank oder den vertrauten Schweißplatz. Es ging hinaus auf die Baustellen, Raffinerien, Großanlagen, gefährliche Orte irgendwo in Deutschland.
Hier lockte das schnelle Geld. Man verdiente mehr als das Doppelte eines normalen Gesellenlohns. Für mich, jung und hungrig nach Freiheit, war das eine Verlockung, der ich nicht widerstehen konnte. Ich wollte verdienen, sparen, mir Dinge leisten, die ich mir bisher nicht leisten konnte.
Doch jeder Euro hatte seinen Preis. Die Schichten waren brutal. Von 22 Uhr bis 7 Uhr morgens, Nacht für Nacht. Der Körper rebellierte, der Kopf war müde, die Augen brannten. Und über allem hing die Gefahr. Auf diesen Baustellen schien es fast ein Gesetz zu sein: Bei jedem Einsatz starb einer.
Ich erinnere mich an die erste Baustelle. Tag für Tag die gleiche Routine: Mitten in der Nacht, gab es im Baucontainer eine heiße Suppe. Ein Wassererhitzer, ein Teller, ein Löffel, das war unser Mittagsessen um 2 Uhr Nachts. Anfangs war es ein Trost. Doch irgendwann konnte ich es nicht mehr sehen. Jeden Tag immer Suppe, derselbe Geschmack von Blech und Gefahr im Mund.
Die Gefahr war keine Theorie. Sie war greifbar. Einmal fiel ein Schraubenschlüssel aus 60 Metern Höhe. Er durchschlug den Helm eines Arbeiters, als wäre er aus Papier. Er starb noch an Ort und Stelle. Ein anderes Mal stürzte ein Kollege ab, weil er sich nicht gesichert hatte. Sekunden, und ein Leben war vorbei. Wir redeten nicht viel darüber. Wir nahmen es hin so, wie man Regen hinnimmt. Aber jeder wusste: Es hätte auch mich treffen können.
Die zweite Baustelle war nicht weniger gefährlich. Aber ich hielt durch. Vielleicht, weil das Geld so gut war. Damals konnte ich gar nicht so viel ausgeben, wie ich verdiente. Am Ende des Monats legte ich mehr als die Hälfte meines Lohns zurück. Für einen Moment fühlte es sich an wie Sicherheit. Wie ein Plan für die Zukunft.
Mein Kollege sagte mal zu mir: „Andreas du bist noch jung, schau das du was anderes machst.“
Doch Firmen sind nicht unverwundbar. Als die ersten finanziellen Probleme auftauchten, war klar, wer als Erster gehen musste: die jungen, unverheirateten Männer. Menschen wie ich. Einfach austauschbar.
Und so stand ich das erste mal ohne Arbeit da.
Teil 5 – Fenster, Frust und der Ruf nach mehr
Nach den Baustellen landete ich bei der Fenstermontage. Ehrliche Arbeit, ja – aber nicht meine. Ich machte den Job, weil ich musste, nicht weil ich wollte. Die Bezahlung war schwach, die Motivation gering, und in mir wuchs eine Unruhe, die ich nicht mehr loswurde.
Immer wieder dachte ich an den Computer. An die Webseiten, die ich inzwischen nebenbei baute. Ende der 90er war das etwas Besonderes. Wer eine Webseite erstellen konnte, war fast schon ein Exot. Ich wusste tief in mir: Das könnte mein Weg sein.
Doch meine Realität sah anders aus. Zum ersten Mal im Leben fühlte ich mich wirklich arm. Ich erinnere mich noch genau: Mein Auto, ein aufgemotzter 2er Golf, mein ganzer Stolz. Er fraß 13 Liter auf 100 Kilometer – ein Wahnsinnsverbrauch. Irgendwann konnte ich mir den Sprit einfach nicht mehr leisten. Also musste ich ihn verkaufen. Zurück blieb eine Schrottkiste, ein Auto, bei dem ich nie wusste, ob es überhaupt anspringen würde. Manchmal musste ich hoffen, dass jemand in der Nähe war, um mich anzuschieben. Dieses Gefühl – nicht zu wissen, ob man nach der Arbeit nach Hause kommt – fraß sich tief in mich hinein. Es war demütigend.
Ungefähr ein Jahr zog ich das so durch. Doch die innere Stimme wurde lauter: „So kann es nicht weitergehen.“ Ich sprach mit dem Betriebsrat, der gleichzeitig als Geselle arbeitete. Ich vertraute ihm meine Pläne an. Ich sagte ihm, dass ich raus aus der Firma musste, um eine Umschulung vom Arbeitsamt zu bekommen. Ich erzählte ihm von meinem Traum, in die Mediengestaltung und IT zu gehen. Dass ich seit meinem zehnten Lebensjahr mit Computern arbeite, dass ich Webseiten baue, dass das meine Zukunft ist.
Er versprach mir: „Beim nächsten Mal, wenn wir Leute ausstellen, bist du dabei.“ Und er hielt Wort. Als es der Firma schlechter ging und Mitarbeiter gehen mussten, war ich einer davon. Für die meisten war das ein Schlag. Für mich war es ein Befreiungsschlag.
So saß ich zum ersten Mal im Wartezimmer des Arbeitsamts. Ich fühlte mich fremd, fehl am Platz. Aber ich hatte einen Plan. Ich sagte den Mitarbeitern dort klar, was ich wollte: „Ich will eine Umschulung. Mediengestalter. Ich habe schon Erfahrung, ich baue Webseiten, ich kenne Computer seit meiner Kindheit. Das ist meine Zukunft.“
Doch das Arbeitsamt vertröstete mich. Papierkram, Wartezeiten, leere Versprechen. Ich saß zuhause, monatelang, über ein Jahr. Es fühlte sich an, als ob mein Leben auf „Pause“ stand, während die Welt an mir vorbeizog.
Und doch tat ich etwas: Ich programmierte weiter. Ich lernte, las Bücher, kaufte mir Zeitschriften. Ich fand andere Leute, die dieselbe Leidenschaft hatten – Webdesign, Programmierung, die digitale Welt. Ich vertiefte meine Kenntnisse. Während ich offiziell „arbeitslos“ war, arbeitete ich in Wahrheit an meinem Fundament.
Aber das Geld wurde immer knapper. Vom Arbeitsamt bekam ich kaum Unterstützung – wenn man vorher schon wenig verdient hatte, war das Arbeitslosengeld ein Witz. Irgendwann rutschte ich ins damalige Hartz-IV-System. 345 Euro im Monat. Für ein Leben, das keins war.
Es war eine harte, zermürbende Zeit. Doch genau in dieser Phase kam der Anruf, der alles veränderte.
Teil 6 – Hans, die Kreuzfahrt und der Schlag ins Gesicht
Der Anruf kam von einem Bekannten. Offiziell war es er, der mir den Job vermittelte doch in Wahrheit hatten meine Eltern ihre Finger im Spiel. Sie machten sich Sorgen. Ich saß nun schon über ein Jahr zu Hause, arbeitslos, ohne echte Perspektive. „Du musst wieder arbeiten“, sagten sie. „Du kannst nicht ewig herumsitzen.“ Also schalteten sie sich ein, sprachen mit Bekannten, und so landete ich dort.
Am nächsten Tag stand ich schon im Betrieb, stellte mich kurz vor, zeigte, was ich konnte und durfte sofort anfangen. Der Lohn war ordentlich da der Bekannte ein gutes Wort für mich einlegte. Die Arbeit war abwechslungsreich, weil ich als Springer überall eingesetzt wurde: Schweißen, Montieren, Maschinen bedienen. Etwa drei Jahre blieb ich dort. Drei Jahre, in denen ich lernte, beobachtete und immer klarer spürte: Ich tickte anders als viele um mich herum.
Eines Tages stand ich mit einem Kollegen, ungefähr in meinem Alter, an der Presse. Unsere Arbeit war stumpf und eintönig: Blech rein in die Maschine, Knopf drücken, Blech umdrehen. Wieder Knopf drücken, Blech raus auf den Stapel. Stundenlang. Tage lang. Immer dasselbe.
Nach einer Weile fragte ich ihn: „Sag mal, kannst du dir vorstellen, das dein ganzes Leben lang zu machen? Jeden Tag hier zu stehen, denselben Knopf zu drücken?“
Er sah mich an, als hätte ich gerade etwas Unsinniges gesagt, und meinte nur: „Mach weiter, stell nicht so blöde Fragen. Das ist meine Arbeit, das passt. Ist doch egal, was ich hier mach. Hauptsache, es ist Arbeit.“
Ich wusste, dass er viel weniger verdiente als ich. Und dass sein Geld nicht einmal ihm gehörte. Seine Frau verwaltete das Konto, hatte die Vollmacht, und er beklagte sich regelmäßig, dass er nie etwas von seinem Lohn sah. Am Monatsanfang war das Geld oft schon wieder weg, und er fluchte über die Enge, in der er lebte. Trotzdem war er zufrieden, so wie es war.
In diesem Moment wurde mir klar: Manche Menschen wollen nichts verändern. Sie wollen Beständigkeit, selbst wenn sie bedeutet, ein Leben lang Knöpfe zu drücken.
Und ebenso klar wurde mir: Ich will das nicht. Ich will mehr.
Es war die gleiche Erkenntnis, die ich später noch stärker spüren sollte, als ich mit Hans zusammenarbeitete.
Hans war über 60 Jahre alt, kurz vor der Rente. Ein Mann, der seine Arbeit kannte, ein ruhiger Kollege. Er erzählte mir oft von seiner Frau und ihrem Traum: eine Kreuzfahrt um die Welt. Mehr als zehn Jahre hatten sie gespart, jeden Monat etwas zur Seite gelegt. 15.000 Euro hatten sie zusammengespart, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. „Wenn ich in Rente bin“, sagte er mit leuchtenden Augen, „dann geht’s endlich los. Dann seh’ ich was von der Welt.“
Ich sah ihn an und dachte: Genau das ist das Bild, das uns allen eingetrichtert wird. Schuften, sparen, verzichten und irgendwann, am Ende, belohnt werden.
Hans ging in Rente, ich arbeitete nun mit seinem Bruder. Wochen vergingen. Eines Tages fragte ich: „Na, wie geht’s Hans? Ist er schon unterwegs auf seinem Schiff?“
Sein Bruder wurde still. Sein Gesicht verfinsterte sich. „Hans ist tot“, sagte er.
Ich starrte ihn ungläubig an. „So etwas sagt man nicht. Hör auf mit solchen Witzen.“
Doch er schüttelte nur den Kopf. „Kein Witz. Krebs. Vor zwei Wochen.“
Es fühlte sich an, als hätte mir jemand die Luft aus der Lunge gezogen. Alles, wofür Hans gelebt hatte, alles, wofür er gespart und geschuftet hatte weg. Sein Traum starb mit ihm, bevor er Wirklichkeit werden konnte.
Ich sah plötzlich meine eigene Zukunft. Ich sah mich an dieser Maschine, Knopf drückend, Jahr für Jahr. Ich sah mich alt, müde, krank, und vielleicht nicht einmal mehr in der Lage, meine eigenen Träume zu leben.
In diesem Moment traf ich eine Entscheidung. Ich meldete mich am nächsten Tag krank, wartete, bis der Aufhebungsvertrag auf dem Tisch lag. Als ich unterschrieb, war es, als würde ich eine unsichtbare Kette sprengen.
Das war mein Schnitt. Die erste Narbe, die mir zeigte: So wie Hans werde ich nicht enden.
Es war der Beginn meiner Reise ins Unternehmertum.