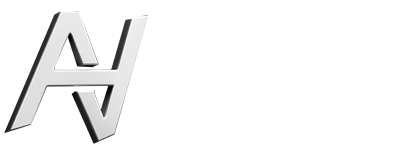Kapitel 2 – Der Weg in die Selbstständigkeit
Teil 7 – Der Aufbruch in die Selbstständigkeit
Nach dem Aufhebungsvertrag stand ich wieder am Anfang. Kein Arbeitsplatz, kein Einkommen aber ein klarer Gedanke: Ich wollte nie wieder an eine Maschine zurück.
Ich meldete mich arbeitslos, diesmal mit einem Plan. Ich wollte kämpfen, bis ich bekam, was ich wollte. Eine Umschulung zum Mediengestalter Digital und Print. Etwas, das zu mir passte, etwas, das mein Interesse und meine Erfahrung mit Computern endlich auf ein solides Fundament stellte.
Die ersten Gespräche beim Arbeitsamt liefen wie immer: freundlich, unverbindlich, leer. Ich legte meine Unterlagen vor, erklärte, dass ich seit meiner Kindheit mit Computern arbeite, dass ich Webseiten baue und in diesem Bereich meine Zukunft sehe. Die Sachbearbeiterin nickte, machte Notizen, lächelte und sagte dann diesen Satz, den ich nie vergessen werde:
„Herr Achatz, das ist im Moment schwierig. Wir brauchen Ihren Beruf. Wir haben so viele freie Stellen.“
Ich nickte, ging heim und schwor mir, diesmal nicht lockerzulassen. Ich schrieb Widersprüche, Beschwerdebriefe, verwies auf Paragraphen, suchte Rat. Nach Wochen bekam ich die Ablehnung. Ich legte erneut Widerspruch ein und als auch der abgelehnt wurde, zog ich vor Gericht.
Es war das erste Mal, dass ich mich wirklich gegen eine Behörde stellte. Ich fühlte mich klein, aber entschlossen. Ich hatte keine Ahnung, wie man vor Gericht argumentiert, aber ich wusste: Wenn ich nichts tue, ändert sich nie etwas.
Der Prozess zog sich hin. Monate vergingen. Mittlerweile war ich über ein Jahr schon „Arbeitslos“. Währenddessen passierte etwas Unerwartetes: Das Arbeitsamt bot mir einen Gründungszuschuss an. Eine finanzielle Starthilfe für Menschen, die sich selbstständig machen wollten. Ich nahm das Angebot an nicht, weil ich plötzlich „Unternehmer“ sein wollte, sondern weil es meine einzige Chance war, endlich das zu tun, was ich wirklich wollte, wo ich meine Erfüllung sah.
Die Bedingung: Ich musste jede 14 Tage einer einer Schulung teilnehmen. Dort sollte mir ein „Unternehmensberater“ beibringen, wie man ein Geschäft aufbaut und einen Businessplan schreibt. Der Mann war freundlich, aber schnell merkte ich: Er wusste alles in der Theorie und nichts aus der Praxis. Er sprach über Businesspläne, Rentabilitätsvorschauen und Marktanalysen, aber wenn ich Fragen zu Kunden, Aufträgen oder Preisen stellte, kam nur Allgemeines zurück.
Ich erkannte das als er mir einen heissen Tipp gab: „Sie müssen Flyer drucken und in der Stadt verteilen, das ist der Weg zu Ihren Kunden.“
Ich nickte, druckte tatsächlich Flyer – und verteilte sie in meiner Stadt.
Ergebnis: null. Keine einzige Anfrage, kein Anruf, kein Interesse. Ich verstand: Wenn man Menschen etwas beibringen will, sollte man es selbst erlebt haben.
Nach der fünften Sitzung hatte ich genug. Ich sagte ihm offen: „Ich komme nicht mehr. Das hier bringt mir nichts.“
Also machte ich mein eigenes Ding. Ich gründete meine kleine Webdesign-Agentur wenn man das überhaupt so nennen konnte.
Durch einen befreundeten Unternehmer aus der Schweiz bekam ich meine ersten zwei echten Aufträge:
eine Website für ein Autohaus und eine für ein Handwerksunternehmen. Beide zusammen brachten mir rund 3 500 Euro ein. Das war mehr, als ich früher in zwei Monaten verdient hatte und diesmal war es kein Geld für Schweiß, Staub und Überstunden, sondern für Wissen, Kreativität und Können.
Ich war stolz. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich, dass ich selbst etwas bewegen konnte. Keine Maschinen, kein Chef, kein Meister nur ich und mein Kopf.
Doch Erfolg ist selten von Dauer, wenn man ihn nicht festigen kann. Nach diesen beiden Projekten hatte mein Schweizer Kontakt keine weiteren Aufträge mehr. Ich saß wieder da und überlegte: Wie komme ich an neue Kunden?
Ich suchte nach Möglichkeiten und fand eine Online-Börse, auf der Agenturen und Freelancer Aufträge finden konnten, passend zu dem CMS, mit dem ich arbeitete. Ich registrierte mich, stellte mein Profil ein und begann, Angebote abzugeben. Es war ein gnadenloser Wettbewerb. Der Billigste, schnellste und überzeugenste bekam den Zuschlag.
Ich lernte schnell, dass man dort kein Unternehmer war man war ein digitaler Tagelöhner. Ich bot mich an für 10 Euro pro Stunde, manchmal weniger, nur um Arbeit zu bekommen. Ich fühlte mich wie ein Arbeiter auf dem virtuellen Basar, der ruft: „Ich mach’s billiger! Hauptsache, ich darf arbeiten!“
Aber ich biss mich durch. Jede Zeile Code, jede Website war Übung. Jeder Auftrag, egal wie klein, war Erfahrung.
Am Ende des ersten Jahres stand die Zahl: 6 800 Euro Umsatz.
Kein Vermögen, aber mein eigenes Geld, selbst verdient. Ich war stolz bis der Brief vom Arbeitsamt kam.
Man gratulierte mir nicht. Stattdessen stand sinngemäß dort:
„Sie haben 3 000 Euro zu viel erwirtschaftet. Diese Summe ist zurückzuzahlen, da sie Ihnen nicht zusteht.“
Ich war fassungslos. Ich hatte jeden Euro gebraucht, um zu leben, um meine Software, meinen Strom, mein Essen zu bezahlen – und jetzt sollte ich es zurückgeben?
Ich vereinbarte eine Ratenzahlung, kleine Beträge, mühsam zusammengekratzt. Einen Monat kam ich in Verzug. Danach war der Plan hinfällig.
Ein paar Wochen später kam ich nach Hause. Gegenüber parkte ein silberner Golf. Ich dachte mir nichts dabei, parkte mein Auto in meiner Einfahrt. Kaum stand ich, rollte der Golf vor und blockierte meine Ausfahrt. Ich wusste, dass wir mal einen Mieter hatten, der Schulden bei der Stromfirma hinterließ. Ich dachte zuerst, die wollten Geld eintreiben.
Die Tür des Golfs ging auf. Ein Mann in Zivil öffnete die Türe und blieb sitzten aus, kein Abzeichen, kein Uniformträger. Er sagte mit lauter Stimme: „Sind Sie Herr Achatz?“
Ich nickte.
Er nickte zurück und sagte nur: „Ich komme jetzt rein. Sie haben Geld vom Arbeitsamt zu erstatten. Die Ratenzahlung ist aufgehoben. Ich muss jetzt pfänden.“
Ich stand da wie versteinert. „Sie kommen hier nicht rein“, sagte ich ruhig. „Steigen Sie wieder in Ihr Auto und verlassen Sie mein Grundstück, sonst rufe ich die Polizei.“
Er zögerte, musterte mich, drehte sich dann um und fuhr tatsächlich davon.
Ich ging ins Haus, setzte mich hin, starrte ins Leere. Das war kein Film, das war Realität. Wenige Tage später kam ein Schreiben: Die Summe blieb fällig. Ich hatte keine Wahl. Ich borgte mir das Geld so unangenehm es war von meiner Mutter.
Ich zahlte ihr dann in Raten alles zurück.
Das war kein glanzvoller Start, kein Traum vom Erfolg. Aber es war mein Start.
Kein Lehrer, kein Arbeitsamt, kein System hatte mir das beigebracht, was ich in diesen Monaten lernte: Wer Freiheit will, muss den Preis zahlen.
Und ich zahlte ihn mit Nerven, Stolz und Schulden.
Doch ich hatte etwas, das mir keiner mehr nehmen konnte:
Das Wissen, dass ich es alleine schaffen konnte.
Teil 8 – Der Preis der Freiheit
Nachdem ich die Sache mit dem Arbeitsamt überstanden hatte, war ich endlich frei, zumindest auf dem Papier. Ich hatte Aufträge, ein kleines Einkommen, eine eigene Website, ein Portfolio, das wuchs.
Zum ersten Mal in meinem Leben verdiente ich Geld mit Kreativität statt mit Muskelkraft. Ich war stolz, aber auch vorsichtig. Denn ich wusste: Jeder Tag ohne Disziplin bedeutete, dass am Monatsende kein Geld da war.
Zum Glück hatte ich etwas, das viele andere nicht hatten: ein Auge für Gestaltung.
Ich konnte Webseiten einfach schöner machen, klarer, moderner, ansprechender. Grafik war mein Vorteil, Ästhetik meine Waffe. Verkaufen konnte ich nicht, verhandeln schon gar nicht. Aber ich konnte bauen. Und das reichte am Anfang.
So gewann ich Kunden, verdiente etwas Geld und sammelte Erfahrungen, oft gute, manchmal bittere.
Ich lernte, dass es Kunden gibt, die fair sind, dankbar, unkompliziert. Und dann gibt es die anderen. Ich nannte sie später „Kunden aus der Hölle“.
Einer von ihnen bleibt mir bis heute im Gedächtnis.
Ein Mann, für den ich eine Website erstellte. Anfangs war er nett, höflich, interessiert. Wir telefonierten fast täglich, stimmten Texte ab, Bilder, Kleinigkeiten. Ich war bemüht, alles perfekt zu machen.
Doch irgendwann kippte die Stimmung.
Es war tief in der Nacht, vielleicht ein, zwei Uhr. Das Telefon klingelte.
Ich erschrak, dachte, es wäre etwas passiert. Wer ruft um diese Uhrzeit an?
Ich hob ab und hörte ihn. Lallend, betrunken, aggressiv.
Er schrie ins Telefon: „Was haben Sie da gemacht?! Ich hab’ einen Brief vom Anwalt! Alles ist falsch! Ich verklag Sie!“
Ich blieb ruhig, versprach, am nächsten Tag alles zu prüfen. Ich sah mir die Website an, kein einziger Fehler. Am Mittag rief er an, entschuldigte sich. Er habe zu viel getrunken, es sei nichts gewesen.
Einmal hätte ich das verstanden. Aber es passierte wieder. Und noch einmal.
Beim dritten Mal platzte mir der Kragen. Ich brüllte ins Telefon:
„Suchen Sie sich jemand anderen! Ich bin raus aus dem Mist! (das war die höfliche Variante und die echte schreib ich lieber nicht).“
Ich legte auf und fühlte mich gleichzeitig wütend und erleichtert.
Das war meine erste Lektion in echter Selbstständigkeit: Nicht jeder Kunde ist ein guter Kunde.
Ein anderer Kunde war weniger laut, aber nicht weniger anstrengend.
Er rief ständig an morgens, abends, zwischendurch. Immer wegen Kleinigkeiten, manchmal nur, um zu plaudern. Ich war freundlich, hörte zu, bis ich merkte: Das hier kostet mich Zeit, die ich nicht habe. Ich verdiente kein Geld damit, seine Geschichten zu hören. Ich musste lernen, Grenzen zu setzen.
Der Höhepunkt kam, als er eines Tages den Hörer seinem Hund gab.
Ja, seinem Hund.
„Sprich mal mit Herrn Achatz“, sagte er. „Bell mal kurz.“
Ich stand da, mit dem Telefon am Ohr, hörte ein Bellen und dachte: Ich bin im falschen Film.
Danach schrieb ich ihm eine E-Mail, wo ich ihm erklärte, dass ich ab sofort die Telefonate minutengenau abrechnen muss.
Ich rechnete wirklich jede Minute ab, sekundengenau. Er rief nie wieder an.
So lernte ich etwas, das mir bis heute bleibt:
Du musst deine Zeit schützen.
Kunden, die deine Grenzen nicht respektieren, zerstören dein Geschäft, bevor es wächst. Es gibt Zeitdiebe.
Ich begann, klare Regeln aufzustellen, ehrlich zu kommunizieren und für alles, was ich tat, auch einen Preis zu verlangen.
Es war eine neue Phase. Ich war kein Lehrling mehr, kein Arbeitnehmer, kein Suchender. Ich war ein Selbstständiger mit allen Freiheiten, aber auch allen Konsequenzen.
Am Monatsende ist ein leeres Konto nicht optimal.
Teil 9 – Zwischen Stillstand und Aufbruch
Ich arbeitete weiter über die Auftragsbörse. Anfangs lief es gut, richtig gut sogar. Ich bekam regelmäßig Projekte, sammelte Bewertungen, baute mir einen kleinen Namen auf. In dieser CMS-Szene kannte man mich irgendwann. Wer ein sauberes, grafisch starkes Projekt wollte kam zu mir da die Kunden immer wieder sagten: „Mich gefielen einfach Ihre Websites besser als die der anderen Leute“.
Aber die Ruhe hielt nicht lange. Jeden Monat tauchten neue Freelancer in der Plattform auf. Immer mehr, immer billiger, immer lauter. Die Aufträge wurden kleiner, die Konkurrenz größer. Es fühlte sich an, als würde ich auf einem Markt stehen, auf dem jeder schreit: „Ich mach’s günstiger!“, und keiner mehr hinhört.
Das zermürbte mich. Ich arbeitete Tag und Nacht, um mitzuhalten. Und trotzdem sah ich andere, die angeblich 10 000 Euro im Monat verdienten für mich damals unvorstellbar. Zehntausend Euro! Ich selbst kratzte irgendwann an der 5 000-Euro-Marke. Einmal. Und schon im nächsten Monat war wieder fast Ebbe.
So war mein Leben: ein ständiges Auf und Ab. Ein Monat voller Arbeit, der nächste leer. Ich hetzte Projekten hinterher, und sobald ich zu viel arbeitete, fehlte mir die Zeit, neue Kunden zu akquirieren.
Selbstständig sein, so merkte ich, bedeutete oft: selbst und ständig.
Ich begann zu hinterfragen.
Was mache ich falsch?
Was mache ich, wenn es nicht mehr funktioniert?
Wie komme ich aus dieser Abwärtspirale raus?
Was wird meine Zukunft aussehen?
Ich suchte nach Antworten und stieß immer wieder auf ein Wort: Vertrieb.
Ich las Artikel im Internet, las Bücher über Verkaufen, Preispsychologie und Akquise. Aber die Theorie fühlte sich leer an. Ich war kein Verkäufer. Ich war Macher. Ich wollte erschaffen, nicht überreden. Ich war nicht der Typ der ein geborener Verkäufer ist. Aber es musste einen Weg geben.
Mehr dazu im nächsten Kapitel.
Und doch spürte ich, dass ich lernen musste, beides zu sein.
Ich probierte neue Wege: bot Schulungen an, zeigte meinen Kunden, wie sie ihre Webseiten selbst pflegen und Inhalte aktualisieren konnten. Ich wollte ihnen helfen, unabhängig zu sein – und gleichzeitig meine Leistung aufwerten.
Und es funktionierte.
Die Kunden waren begeistert. Manche schrieben mir Wochen später, dass sie über ihre neue Website erste Anfragen bekamen – echte Kundenanfragen, über das Kontaktformular, ohne Werbung, ohne Aufwand.
Wenn sie mir das erzählten, spürte ich einen tiefen Stolz.
Ich wusste: Das, was ich tue, bringt anderen Erfolg.
In diesen Momenten verstand ich etwas Wesentliches.
Ich war vielleicht noch kein Unternehmer, aber ich hatte etwas, das viele Unternehmen suchten: eine Lösung, die funktioniert.
Und genau das war der Anfang meiner nächsten Entwicklung.
Ich war noch nicht dort, wo ich hinwollte. Aber ich wusste, dass ich auf dem richtigen Weg war.
Der Weg war holprig, chaotisch, voller Unsicherheiten – doch jedes Projekt, jeder Kunde, jede durchgearbeitete Nacht brachte mich näher an das, was später mein Leben bestimmen sollte: Menschen durch Marketing zum Erfolg zu führen.